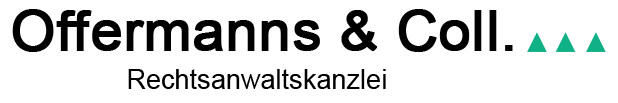Mandanteninformation
Corona-Pandemie
Wir halten unseren Kanzleibetrieb unter Beachtung der notwenigen Vorsichtsmaßnahmen für Sie aufrecht. Gewisse Veränderungen unsere Betriebsabläufe lassen sich aber nicht vermeiden.
Deshalb bitten wir Sie,
- statt eines Termins für eine persönliche Besprechung einen Telefontermin zu vereinbaren. Dies gilt sowohl für den Fall, dass wir Sie schon vertreten, als auch wenn Sie uns ein neues Mandat erteilen wollen.
- Bevorzugt möchten wir mit Ihnen Dokumente nur auf elektronischem Wege austauschen. Alternativ können Sie uns die Dokumente durch Einwurf in den Hausbriefkasten oder per Post zukommen lassen.
Allgemeine Information
Viele unserer Mandanten informieren sich gerne vorab - häufig auch digital. Wir wissen jedoch aus Erfahrung, dass gerade im Internet viele unzuverlässige oder veraltete Quellen zu finden sind. Lesen Sie lieber direkt hier auf unserer Seite monatlich aktuelle Entscheidungen zum Familienrecht und Erbrecht sowie andere für Sie relevante und interessante Informationen.
Bitte beachten Sie, dass dieser Dienst keine Rechtsberatung durch einen Anwalt oder eine Anwältin ersetzen kann. Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!
Auf dieser Seite finden Sie aktuelle Mandanteninformationen. Wenn Sie recherchieren oder ältere Ausgaben betrachten möchten, können Sie hier unser Archiv aufrufen.
Zum Thema Erbrecht
- Erbscheinsverfahren: Was passiert, wenn das Testament im Original unauffindbar ist?
- Erheblicher Pflichtverstoß: Geldentnahme aus Nachlass führt zur Verwirkung der Testamentsvollstreckervergütung
- Gemeinschaftliches Testament: Wiederverheiratungsklausel zur Vorerbschaft ohne Bindungswirkung auf Verfügungen von Todes wegen
- Nachweis der Rechtsnachfolge: Keine Pflicht für Registergericht, Gleichwertigkeit ausländischer Nachweise eigenständig zu prüfen
- Vertretungsverhältnisse beachten: Genehmigungsfreiheit einer Erbanteilsübertragung an einen Minderjährigen
Wird ein Erbschein auf der Grundlage eines Testaments beantragt, wird in der Regel auch das entsprechende Testament im Original vorgelegt. Wie mit dem Fall umzugehen ist, wenn das Testament im Original nicht auffindbar ist, war Gegenstand der folgenden Entscheidung des Brandenburgischen Oberlandesgerichts (OLG).
Der Erblasser war in zweiter Ehe verheiratet. Nach seinem Tod hat die Ehefrau einen Erbschein beantragt und angegeben, dass kein Testament des Erblassers vorhanden sei. Etwa einen Monat später teilte sie dem Nachlassgericht mit, dass der Erblasser ein handschriftliches Testament hinterlassen habe, in dem er sie als Alleinerbin eingesetzt habe. Das Testament habe sie bislang aber nicht finden können. Mehrere Monate später reichte sie beim Nachlassgericht die Kopie eines von ihr eigenhändig geschriebenen und mit insgesamt drei Unterschriften versehenen Testaments vom 20.07.2018 ein, in dem die Eheleute sich wechselseitig zu Alleinerben eingesetzt haben. Dieses Testament war von der Ehefrau, dem Erblasser sowie einem Zeugen unterschrieben worden. Der Sohn des Erblassers aus erster Ehe beantragte hingegen die Erteilung eines gemeinschaftlichen Erbscheins auf der Basis der gesetzlichen Erbfolge. Nachdem das Nachlassgericht zunächst noch einen Erbschein zugunsten der Ehefrau auf der Basis der Kopie des Testaments erteilt hatte, hob das OLG diese Entscheidung wieder auf.
Das Gericht begründete seine Entscheidung damit, dass die Ehefrau die Feststellungslast für das von ihr vorgelegte Testament trägt, das jedoch nur in Kopie vorliegt. Ein nicht mehr vorhandenes Testament ist zwar nicht allein wegen seiner Unauffindbarkeit ungültig; Form und Inhalt des Testaments können mit allen zulässigen Beweismitteln festgestellt werden - auch durch Vorlage einer Kopie oder die Benennung von Zeugen. Hier konnte die Ehefrau den Beweis über die Errichtung eines formgültigen Testaments nach Ansicht des Gerichts nicht führen. Zweifel an der Errichtung des Testaments gingen daher zu Lasten der Ehefrau. In Ermangelung einer Verfügung von Todes wegen kam stattdessen die gesetzliche Erbfolge zum Tragen - mit der Folge, dass ein gemeinschaftlicher Erbschein zu erteilen war.
Hinweis: Im Fall der Unauffindbarkeit eines Testaments besteht keine Vermutung, dass dieses vom Erblasser vernichtet worden ist.
Quelle: Brandenburgisches OLG, Beschl. v. 03.04.2025 - 3 W 53/24
| zum Thema: | Erbrecht |
(aus: Ausgabe 06/2025)
Ein Testamentsvollstrecker kann für seine Tätigkeit eine angemessene Vergütung verlangen, sofern der Erblasser nicht etwas anderes bestimmt hat. Ein Anspruch auf eine solche Vergütung kann aber auch entfallen, wenn dem Testamentsvollstrecker ein Fehlverhalten vorgeworfen werden kann. Im folgenden Fall des Oberlandesgerichts München (OLG) war ein Notar zum Testamentsvollstrecker eingesetzt worden.
Der Testamentsvollstrecker ließ in seiner Eigenschaft unter anderem ein Nachlassverzeichnis erstellen und Immobilien aus dem Vermögen der Erblasserin schätzen. Hierfür erhielt er eine Vergütung in Höhe von ca. 117.000 EUR. Zudem hatte sich der Testamentsvollstrecker weitere 27.000 EUR aus dem Nachlass entnommen, um Kosten für ein Gerichtsverfahren zu decken, von dem er persönlich betroffen war. Die Erben waren der Ansicht, dass es sich hierbei um eine erhebliche Pflichtverletzung gehandelt habe, die dazu führe, dass der Testamentsvollstrecker auch seinen Vergütungsanspruch zurückzahlen müsse. Die Entnahmen für die Kosten des Gerichtsverfahrens hatte der Testamentsvollstrecker in der Zwischenzeit wieder an den Nachlass zurückgeführt.
Sowohl das vorinstanzliche Landgericht als auch das OLG waren der Ansicht, dass der Testamentsvollstrecker mit der Entnahme von insgesamt 27.000 EUR aus dem Nachlass für eigene Zwecke erheblich gegen seine Pflichten verstoßen habe. Hieran ändert sich auch nichts dadurch, dass er den Geldbetrag an den Nachlass zurückgezahlt habe. Die Pflichtverletzung wurde als derart schwerwiegend eingestuft, dass dies zur Folge hatte, dass auch der Vergütungsanspruch des Testamentsvollstreckers damit erloschen war.
Hinweis: Grundsätzlich vertritt der Testamentsvollstrecker den Nachlass in Rechtsstreitigkeiten. Richtet sich diese Rechtsstreitigkeit aber gegen den Testamentsvollstrecker selbst, sind die Erben dazu berechtigt, den Prozess selbst zu führen.
Quelle: OLG München, Urt. v. 07.04.2025 - 33 U 241/22
| zum Thema: | Erbrecht |
(aus: Ausgabe 06/2025)
Wechselbezügliche Verfügungen im Rahmen eines gemeinschaftlichen Testaments können nach dem Tod des Erstversterbenden nicht ohne weiteres geändert werden. Die Eheleute haben daher die Möglichkeit, hiervon abweichende Vereinbarungen zu treffen, so dass der überlebende Ehegatte in seiner Verfügungsbefugnis frei ist. Eine derartige Vereinbarung war Gegenstand einer Entscheidung des Oberlandesgerichts Düsseldorf (OLG).
Die Eheleute hatten im Jahr 1980 ein gemeinschaftliches Testament errichtet und sich gegenseitig zu alleinigen Erben eingesetzt. Darüber hinaus verfügten sie, dass Erben des überlebenden Ehegatten die gemeinsamen Kinder zu gleichen Teilen sein sollten. Das Testament enthielt des Weiteren eine Klausel, dass dem überlebenden Ehepartner keinerlei Beschränkungen auferlegt sein sollen - mit Ausnahme des Falls der Wiederheirat. In diesem Fall sollte der überlebende Ehegatte lediglich Vorerbe sein. Das Testament enthielt zudem eine Pflichtteilsstrafklausel in Bezug auf die gemeinsamen Kinder. Schließlich verstarb die Ehefrau bereits kurz nach der Errichtung des Testaments.
Der Erblasser errichtete seinerseits kurz vor seinem Tod ein weiteres, eigenhändiges gemeinschaftliches Testament mit seiner zweiten Ehefrau und widerrief alle vorherigen Verfügungen von Todes wegen. Die Eheleute setzten sich auch in diesem Fall wechselseitig zu Alleinerben ein, wobei eine neue Schlusserbeneinsetzung erfolgte. In der Folge entstand ein Streit darüber, ob der Erblasser nach dem Tod seiner Ehefrau überhaupt noch dazu befugt gewesen sei, eine neue Schlusserbeneinsetzung vorzunehmen.
Sowohl das Nachlassgericht als auch das OLG bestätigten, dass der Erblasser auch nach dem Tod seiner ersten Ehefrau dazu berechtigt war, eine neue Verfügung hinsichtlich der Schlusserben zu treffen. Dies resultierte zum einen aus dem Testament selbst, da die Eheleute verfügt haben, dass dem überlebenden Ehepartner keinerlei Beschränkungen auferlegt sein sollten. Auch die Wiederverheiratungsklausel führte nicht dazu, dass der Erblasser in seinen Befugnissen beschränkt war. Die Klausel hatte nur zur Folge, dass der überlebende Ehepartner als Vorerbe in seinen Befugnissen unter Lebenden beschränkt war. Daraus könne jedoch nicht die Schlussfolgerung gezogen werden, dass sich diese Beschränkung auch auf Verfügungen von Todes wegen erstreckt.
Hinweis: Eine Pflichtteilsstrafklausel in einem gemeinschaftlichen Testament kann ein Hinweis darauf sein, dass diese Verfügung wechselbezüglich ist und nach dem Tod nicht abgeändert werden soll. Dies wird nicht anzunehmen sein, wenn eine Freistellungsklausel - wie in diesem Fall - in dem Testament enthalten ist.
Quelle: OLG Düsseldorf, Beschl. v. 11.03.2025 - 3 W 4/25
| zum Thema: | Erbrecht |
(aus: Ausgabe 06/2025)
Erbfälle sind nicht nur im privaten Bereich, sondern oft auch im beruflichen Kontext mit Konsequenzen verbunden. Sie können bei Letzterem beispielsweise die Notwendigkeit nach sich ziehen, dass Eintragungen im Handelsregister vorgenommen werden müssen. Im Fall des Hanseatischen Oberlandesgerichts in Bremen (OLG) ging es um die Eintragung der Rechtsnachfolge nach dem Tod eines Kommanditisten einer KG.
Zum Zweck der Eintragung der Änderung im Handelsregister wurde ein Beschluss des österreichischen Bezirksgerichts Salzburg als Nachweis der Erbfolge vorgelegt. Das Registergericht wies jedoch darauf hin, dass ein Eintragungshindernis bestehe, da kein ausreichender Nachweis über die Erbfolge vorgelegt worden sei. Gegen diese Entscheidung richtete sich die Beschwerde, die nun jedoch zurückgewiesen wurde.
Das OLG stellte klar, dass das Registergericht durchaus zu Recht die Vorlage eines deutschen Erbscheins oder eines europäischen Nachlasszeugnisses verlangt habe. Das Gericht kommt damit seinem pflichtgemäßen Ermessen nach, wenn es Urkunden genügen lässt, die einem deutschen Erbschein gleichstehen. Das Registergericht sei aber nicht verpflichtet, die Gleichwertigkeit ausländischer Nachweise eigenständig rechtlich zu prüfen, um die Rechtsnachfolge nachzuweisen. Hintergrund ist, dass derartige unter Umständen umfangreiche Ermittlungen zu Verzögerungen bei den Handelsregistereintragungen führen können.
Hinweis: Zweck des europäischen Nachlasszeugnisses ist, dass die berechtigten Personen - wie beispielsweise Erben - ihren Status und ihre Befugnisse in einem anderen Mitgliedstaat einfach nachweisen können, um somit eine schnelle unkomplizierte Abwicklung der Erbsache mit grenzüberschreitendem Bezug zu ermöglichen.
Quelle: Hanseatisches OLG in Bremen, Beschl. v. 18.03.2025 - 2 W 37/24
| zum Thema: | Erbrecht |
(aus: Ausgabe 06/2025)
Um Minderjährige zu schützen, dürfen bestimmte Verfügungen zu ihren Gunsten nicht getroffen werden, sobald hiermit auch die Übernahme von Belastungen verbunden ist. Da sie in der Regel von ihren Eltern gesetzlich vertreten werden, bedarf es bei Übertragungen an die Kinder häufig einer Genehmigung durch das Familiengericht. Ein Fall, in dem die Eltern von ihrem Vertretungsrecht ausdrücklich ausgeschlossen waren, war kürzlich Gegenstand einer Entscheidung des Oberlandesgerichts Düsseldorf (OLG).
Ein Großvater wollte einen Anteil seines Erbes an seine drei Enkel übertragen, von denen einer zum Zeitpunkt der Übertragung noch minderjährig war. In der notariellen Urkunde wurde der Großvater von Nachlassverbindlichkeiten durch den Enkel freigestellt. In der notariellen Vereinbarung wurde der minderjährige Enkel allein von seinem Vater vertreten. Das Grundbuchamt war der Ansicht, dass für die Umsetzung der Erbteilsübertragung und die Umschreibung im Grundbuch die Bestellung eines Ergänzungspflegers und eine familiengerichtliche Genehmigung einzuholen waren; der Sohn hätte in diesem Fall nicht vom Vater vertreten werden dürfen.
Diese Entscheidung wurde durch das OLG aufgehoben. Nach Ansicht des Gerichts handelte es sich eben nicht um ein Rechtsgeschäft, bei dem der Minderjährige für fremde Schulden haftet. Der im Gesetz vorgesehene Ausschluss des Vertretungsrechts betrifft nur jenen Elternteil, der hiervon direkt betroffen ist. Dies wäre bei der Erbteilsübertragung zugunsten der Enkel die Tochter des Erblassers, also die Mutter seiner drei Enkel. Diese hat das minderjährige Kind im Rahmen der Erbteilsübertragung aber gerade nicht vertreten.
Hinweis: Verfügungen im Rahmen einer vorweggenommenen Erbfolge sind ein häufig angewandtes Instrumentarium zur Gestaltung zu Lebzeiten des Erblassers. Gerade bei Verfügungen zugunsten Minderjähriger ist besonders auf die Vertretungsverhältnisse zu achten.
Quelle: OLG Düsseldorf, Beschl. v. 14.03.2025 - 3 W 9/25
| zum Thema: | Erbrecht |
(aus: Ausgabe 06/2025)
Zum Thema Familienrecht
- Bei hohem Betreuungsanteil: Mitbetreuung rechtfertigt Herabgruppierung des Kindesunterhalts
- Sohn oder Berufsbetreuer? Wie bei der Betreuerauswahl korrekt vorzugehen ist
- Teilungsversteigerung: Kindeswohl ist auch bei Zwangsvollstreckung zu beachten
- Verabredung zum Mord: Ehemann darf zum Nebenkläger gegen mordlüsterne Ehefrau werden
- Versorgungsausgleich: Kein Versorgungsausgleich bei folgenschwerer Körperverletzung
Beide Eltern sind den Kindern zu Unterhalt verpflichtet - durch Betreuung oder finanziell. Was passiert, wenn ein Elternteil an sich Barunterhalt schuldet, die Kinder aber de facto mitbetreut, war Dreh- und Angelpunkt im folgenden Fall des Oberlandesgerichts Braunschweig (OLG).
Nach der Trennung im Dezember 2019 blieben die drei Kinder im Haushalt der Kindesmutter. Der Vater zahlte für die Kinder Unterhalt in Höhe von 100 % des Mindestunterhalts abzüglich des hälftigen Kindergelds. Zudem betreute er sie in jeder ungeraden Kalenderwoche von Mittwoch nach Schulschluss bis Montagmorgen zum Schulbeginn, zusätzlich während der Hälfte der Schulferien. Als der Vater vom Amtsgericht verpflichtet wurde, rückwirkend Kindesunterhalt von 115 % des Mindestunterhalts der jeweiligen Altersstufe zu zahlen, legte er Beschwerde gegen die Festsetzung des Unterhalts ein, soweit dieser 100 % übersteigt.
Der Vater hatte damit vor dem OLG auch Erfolg: Er blieb der Zahlungspflicht von 100 % des Mindestunterhalts der jeweiligen Altersstufe der Kinder nach der Düsseldorfer Tabelle verpflichtet (abzüglich des hälftigen Kindergeldes). Dies ist wegen der beachtlichen Mitbetreuung der Kinder durch den Vater gerechtfertigt. Der Vater betreut die drei Kinder an fünf von 14 Tagen. Addiert man hierzu noch die Betreuung während der Hälfte der Schulferien, entspricht dies einem Betreuungsanteil von gut 35 % - also von mehr als einem Drittel. Ein deutlich erweiterter Umgang kann daher auch zu einer Herabgruppierung der Unterhaltspflicht führen. Dabei spielt es eine Rolle, inwieweit bei der Betreuungszeit über die Gewährung von Naturalunterhalt der Unterhaltsverpflichtung bereits entsprochen und der hauptbetreuende Elternteil entlastet wird.
Hinweis: Auch bei einer Trennung sollte sich jeder Elternteil seine Betreuungsanteile bewusst machen, zum Beispiel durch eine schriftliche Aufstellung. Vielleicht sind diese zu hoch, so dass der Barunterhalt reduziert werden kann.
Quelle: OLG Braunschweig, Beschl. v. 04.04.2025 - 1 UF 136/24
| zum Thema: | Familienrecht |
(aus: Ausgabe 06/2025)
Die Feststellung, dass eine Person unter Betreuung gestellt werden muss, ist die eine Sache. Die andere ist es, einen geeigneten Betreuer zu finden. Besonders schwierig wird es, wenn Familienmitglieder gegen Berufsbetreuer konkurrieren. So hat hier erst der Bundesgerichtshof (BGH) entscheiden, wie für eine rechtsgültige Bewertung in solchen Fällen vorzugehen ist.
Eine im Jahr 1934 geborene Frau leidet an einer Aphasie sowie schweren psychischen Störungen und kann ihre Angelegenheiten rechtlich nicht mehr besorgen. Das Amtsgericht (AG) bestellte deswegen einen Berufsbetreuer sowie eine berufliche Verhinderungsbetreuerin. Dagegen wendete sich der einzige Sohn der Betreuten. Die Betreuung müsse ihm als dem einzigen Sohn übertragen werden. Das Gericht sah ihn aber als ungeeignet an. Er habe sich nachweislich unvernünftig und auch übergriffig der Mutter gegenüber verhalten. Der Sohn wiederum gab an, sich bessern zu wollen. Dem AG reichte das nicht, es hielt dieses Versprechen für eine bloße Absichtserklärung. Während die Beschwerde des Sohns beim Landgericht (LG) noch erfolglos blieb, konnte er vor dem BGH nun einen Etappensieg erringen.
Nach § 1816 Abs. 2 Satz 1 Bürgerliches Gesetzbuch muss dem Wunsch des Betroffenen nach einem bestimmten Betreuer entsprochen werden, außer dieser ist ungeeignet. Schlägt der Betroffene niemanden vor, sind Familienangehörige und Berufsbetreuer gegeneinander abzuwägen. Will ein Familienangehöriger die Betreuung übernehmen und steht dem kein Wunsch des Betroffenen selbst entgegen, ist dem Familienangehörigen der Vorzug zu geben - außer, er ist für die Betreuung ungeeignet. Ob der Sohn ungeeignet ist, hatte das LG jedoch erst gar nicht ausermittelt. Genau aus diesem Grund wurde der Fall dorthin zurückverwiesen.
Hinweis: Achten Sie in einer ähnlichen Situation darauf, dass die Eignung des Betreuers aus dem Familienkreis umfassend beurteilt wird. Es muss eine Gesamtschau vorgenommen werden: War der Familienangehörige unvernünftig? Wenn ja, warum? Wie lange ist das her? Wie ist die Prognose? Nur, wenn die Gesamtschau negativ ist, kann ihm die Betreuung versagt werden.
Quelle: BGH, Beschl. v. 05.03.2025 - XII ZB 260/24
| zum Thema: | Familienrecht |
(aus: Ausgabe 06/2025)
Die Teilungsversteigerung einer gemeinsamen Immobilie kann dem anderen Ehegatten gegenüber rücksichtslos sein, etwa wenn sein Vermögen nachhaltig geschädigt wird oder das Wohl der gemeinsamen Kinder auf dem Spiel steht. Doch wie so oft, steht auch in solchen Fällen die gerichtliche Abwägung vor einem Urteil - so auch im Fall vor dem Amtsgericht Frankenthal (AG).
Die Eheleute leben getrennt, sind aber noch nicht geschieden. Ein Wohnhaus, das im gemeinsamen Eigentum der Ehegatten stand, sollte nun auf Betreiben des Mannes zwangsversteigert werden. Es gehört zu 2/3 der Ehefrau, zu 1/3 dem Mann und wird von der Frau mit den beiden gemeinsamen Kindern bewohnt. Die Tochter ist in kinderpsychologischer Behandlung, die laut der Mutter wegen der Trennung erforderlich sei. Deswegen wollte sie die Teilungsversteigerung auch untersagen lassen.
Grundsätzlich sind das Verlangen und die Durchführung einer Teilungsversteigerung nachvollziehbar. Im Zuge der Scheidung soll auch eigentumsrechtlich Klarheit geschaffen werden. Im Einzelfall kann das Betreiben der Teilungsversteigerung gegenüber dem anderen Ehegatten rücksichtslos sein. Es müssen daher stets die beiderseitigen Interessen abgewogen werden. Auf Seiten des Mannes stehen vermögensrechtliche Interessen - auf Seiten der Frau stehen neben deren Vermögensinteressen aber auch psychologische Gründe. Sie lebt mit den gemeinsamen Kindern in dem Haus. Eine der Töchter hat wegen der Trennung psychologische Probleme, durch die Versteigerung könnten sich diese noch verstärken. Zudem gehören der Ehefrau 2/3 des Hauses. Die Interessen der Ehefrau sind laut AG demnach höher zu bewerten als die Interessen des Mannes. Sie konnte also mit den Kindern im Haus bleiben.
Hinweis: Ob einem Antrag auf Teilungsversteigerung stattgegeben wird oder nicht, richtet sich also immer nach den berechtigten Interessen. Zur Feststellung der berechtigten Interessen zählen Vermögensinteressen genauso, wie sonstige berechtigte Interessen. Hier können Sie so viel wie möglich in die Waagschale werfen: Eigentumsanteile, Kindeswohl und nicht zuletzt auch die eigene psychische Gesundheit.
Quelle: AG Frankenthal (Pfalz), Beschl. v. 24.03.2025 - 5 K 13/24
| zum Thema: | Familienrecht |
(aus: Ausgabe 06/2025)
Viele heiraten - viele trennen sich. Zwar lassen Krimis anderes mutmaßen, doch in der Realität wollen wohl die wenigsten lieber über einen Auftragskiller statt über eine Scheidung Fakten schaffen lassen. Wenn man dennoch diesen illegalen Weg wählt und schließlich versagt - so wie im Fall vor dem Landgericht Ansbach (LG) -, darf in solchen Konstellationen das einst ins Visier geratene Opfer im Strafverfahren als Nebenkläger auftreten.
Der Ehemann war in Urlaub in Thailand. Seine Frau und deren Liebhaber wollten endlich freie Bahn haben und beschlossen, den Ehemann töten zu lassen. Dazu beauftragten sie einen Auftragskiller. Der Killer nahm zwar das Geld an, die Tötung wollte er dann doch nicht ausführen. Der Plan kam schließlich ans Licht. Ehefrau, Liebhaber und Killer wurden wegen Verabredung zum Mord angeklagt. Am Ende saßen alle drei wegen Verabredung zum Mord - der Killer zudem wegen Betrugs - auf der Anklagebank beim LG.
Nach der Untersuchungshaft nahm der Ehemann die Ehefrau zwar wieder in die eheliche Wohnung auf, beantragte aber die Zulassung als Nebenkläger im Strafverfahren. Dies wurde ihm vom LG schließlich auch erlaubt. Nach § 395 Abs. 3 Strafprozessordnung kann die Nebenklage zugelassen werden, wenn diese wegen der schweren Folgen der Tat zur Wahrnehmung der Interessen des Geschädigten geboten erscheint. Das war hier der Fall. Schließlich sollte dem Mann das Leben genommen werden. Zudem hat er mit der Ehefrau gemeinsames Vermögen und auch gemeinsame Kinder. Es besteht also ein Interesse am Ausgang des Verfahrens.
Hinweis: Das ist sicher kein klassischer familienrechtlicher Fall. Sie sehen aber, dass Sie aus der familiären Verbundenheit Ihre Position auch in anderen Rechtsbereichen stärken können. Wäre der Mann nicht mit der Frau verheiratet gewesen und hätten sie keine gemeinsamen Kinder, wäre die Nebenklage wahrscheinlich versagt worden.
Quelle: LG Ansbach, Beschl. v. 04.03.2025 - Ks 1060 Js 3390/23
| zum Thema: | Familienrecht |
(aus: Ausgabe 06/2025)
Häusliche Gewalt ist nach wie vor ein großes gesellschaftliches Problem. Wenn sie zu folgenschweren Körperverletzungen während der Ehe führt, kann sogar der Versorgungsausgleich ausgeschlossen werden. Genau dies musste das Oberlandesgericht Stuttgart (OLG) im Folgenden überprüfen, nachdem die Vorinstanz dem Gewalttäter einen solchen Ausgleich noch zugesprochen hatte.
Eine 2011 in der Türkei geschlossene Ehe wurde am 03.04.2024 rechtskräftig in Deutschland geschieden. Ein gemeinsamer Sohn war 2009 geboren worden. Der Ehemann hatte nie gearbeitet und während der Ehezeit illegale Drogen konsumiert. Am 21.02.2014 hatte der Mann die Ehefrau auf einer Busfahrt zu einer Drogenentzugsklinik an einer Haltestelle aus dem Bus gezerrt. Er schlug so massiv auf sie ein, dass sie bewusstlos wurde und auf dem rechten Auge erblindete. Der Sohn verblieb bei der Mutter, der Vater zahlte keinen Unterhalt und war mehrfach im Gefängnis. Er beantragte schließlich den Versorgungsausgleich. Das Amtsgericht führte diesen auch durch. Die Ehefrau erhob Beschwerde hiergegen.
Damit war sie auch erfolgreich. Denn die Durchführung des Versorgungsausgleichs zu ihren Lasten wäre in Augen des OLG grob unbillig (§ 27 Gesetz über den Versorgungsausgleich). Schließlich hat der Ehemann ein Verbrechen zu ihren Lasten begangen, unter dessen Folgen sie lebenslänglich leiden wird. Es wäre unerträglich, den Ehemann dann noch vom Versorgungsausgleich profitieren zu lassen. Auch hätte der Vater in den Phasen in Freiheit arbeiten können, um so zumindest den Kindesunterhalt zahlen zu können. Dies hatte er aber schuldhaft nicht getan, was ebenso für einen Ausschluss des Versorgungsausgleichs spricht.
Hinweis: Soll der Versorgungsausgleich ausgeschlossen werden, sind alle Gesamtumstände des Einzelfalls abzuwägen. Dabei kommt es auch darauf an, wie sich der Ex-Partner verhalten hat. Bei Gewalt in der Ehe, durch die dauerhafter Schaden entstanden ist, und durch die schuldhafte Vereitelung von Unterhalt kann der Versorgungsausgleich kippen. Wichtig ist, dass alle Punkte, die in die Gesamtabwägung einfließen sollen, ordentlich aufgelistet und eingebracht werden.
Quelle: OLG Stuttgart, Urt. v. 27.01.2025 - 11 UF 222/24
| zum Thema: | Familienrecht |
(aus: Ausgabe 06/2025)
Zum Thema Sonstiges
- Augen auf im Supermarkt: Sturz über Preiseinschub nicht durch Verletzung von Verkehrssicherungspflichten verursacht
- Fisch gegen Amphibie: Forellenzüchter wehrt sich als Anlieger erfolgreich gegen Straßensperrung für Krötenwanderung
- Geplatzter Haustraum: Was eine Nichtabnahmeentschädigung ist und wann sie anfällt
- Minderjährige Sportler: EuGH bestätigt potentielle Missbräuchlichkeit von Vertragskonditionen bei Nachwuchsverpflichtungen
- Verweigerter Kreuzfahrtantritt: Positiver PCR-Test kann in Risikosphäre der reisenden Vertragspartei fallen
Mit der Verletzung der Verkehrssicherungspflichten ist es immer wieder so eine Sache - war das fahrlässig, und wenn ja, von welcher Seite überhaupt? Und da jeder Fall einzeln betrachtet werden muss, war das Landgericht München II (LG) gefragt, sich nach einem Sturz in einem Supermarkt auf Ursachenforschung zu begeben.
Die klagende Kundin eines Supermarkts hatte in selbigem einen Gang mit Aktionsartikeln beschritten, als sie mit ihrem Fuß an einen leicht hervorstehenden Einschub stieß, der zur Preiskennzeichnung an einer Europalette befestigt war. Dieser Preisschildeinschub löste sich, die Frau stürzte und erlitt dabei einen Bruch des Oberschenkelknochens. Schließlich klagte sie gegen den Supermarktbetreiber auf Schmerzensgeld und Schadensersatz. Denn für sie war die Sache klar: Der Betreiber hatte die ihm obliegenden Verkehrssicherungspflichten nicht beachtet.
Das LG war anderer Ansicht und wies die Klage ab, da es keine Verletzung der Verkehrssicherungspflichten feststellen konnte. Denn Kameraaufnahmen belegten, dass von der Europalette kein Risiko ausgegangen war. Dass das Preisschild nicht angeschraubt war, habe das Risiko nicht nennenswert erhöht. Im Gegensatz zur Behauptung der Kundin stand der Preiseinschub auch nicht ab, sondern lag bündig an der Palette an. Das LG wies zudem darauf hin, dass eine 100%ige Sicherheit in einem Supermarkt auch prinzipiell nicht erwartet werden könne.
Hinweis: Ob in einem Ladengeschäft die Verkehrssicherungspflichten beachtet werden oder nicht, lässt sich häufig erst im Nachhinein durch ein Gericht feststellen. Natürlich kann keine 100%ige Sicherheit in einem Supermarkt erwartet werden. Trotzdem lohnt es sich in solchen Fällen, den Rechtsanwalt des Vertrauens zu fragen, ob ein Rechtsstreit zur Erlangung eines Schmerzensgeldes und von Schadensersatz Aussicht auf Erfolg hat.
Quelle: LG München II, Urt. v. 25.02.2025 - 1 O 576/24
| zum Thema: | Sonstiges |
(aus: Ausgabe 06/2025)
Selbst wenn die Überschrift in ihrer Kürze lustig anmuten mag, letztlich war die Maßnahme, die ein Landkreis hier erließ, für einen gewerblichen Straßenanlieger existenzgefährdend. Daher war im Folgenden auch das Verwaltungsgericht Osnabrück (VG) gefragt. Es musste sich mit einer behördlich angeordneten Straßensperrung zugunsten einer Krötenwanderung beschäftigen.
Der Landkreis Osnabrück hatte auf Antrag des NABU e.V. seine straßenverkehrsrechtliche Zustimmung zur teilweisen Sperrung der Bergstraße in Bad Iburg vom 01.02. bis zum 30.04.2025, jeweils von 18 Uhr bis 8 Uhr, erteilt. Die Maßnahme sei zum Schutz der Amphibien erforderlich und angemessen. Dagegen klagte ein Anlieger, der an der Straße eine Forellenzucht und den Handel einschließlich der Direktvermarktung betrieb. Er hielt das Ganze für alles andere als angemessen. Und da lag er nicht falsch.
Das VG war auf der Seite des Forellenzüchters und beschloss die aufschiebende Wirkung einer Klage gegen die teilweise Sperrung der Bergstraße. Die Behörde wurde einstweilen verpflichtet, unverzüglich die Verkehrsschilder zu entfernen und die Schranken zu öffnen. Die Sperrung war schlichtweg unverhältnismäßig und außerdem zu unbestimmt. Insbesondere hätten die wirtschaftlichen und persönlichen Interessen des Antragstellers stärker berücksichtigt werden müssen.
Hinweis: Das Vorgehen gegen behördliche Anordnungen ist in der Regel erfolgversprechender, wenn ein Rechtsanwalt das Verfahren begleitet.
Quelle: VG Osnabrück, Beschl. v. 29.03.2025 - 1 B 10/25
| zum Thema: | Sonstiges |
(aus: Ausgabe 06/2025)
Wenn ein Hauskauf wider Erwarten doch nicht zustande kommt, das Darlehen jedoch bereits vereinbart wurde, verlangt die Bank häufig eine sogenannte Nichtabnahmeentschädigung. Wer im Ernstfall dafür haften muss - etwa, wenn der Verkäufer wie hier kurz vor Abschluss abspringt -, hat der Bundesgerichtshof (BGH) kürzlich entschieden.
Ein Ehepaar beabsichtigte, ein Einfamilienhaus zu kaufen. Als die angefragte Bank die Finanzierung über 450.000 EUR ablehnte, kontaktierte das Paar einen Darlehensvermittler. Daraufhin unterzeichneten sie einen Darlehensvertrag über 350.000 EUR und ein Beratungsprotokoll. Darin war folgender Hinweis enthalten: "Wichtig! Unterzeichnen Sie Bau-, Kauf- und Finanzierungsverträge erst, wenn alle wichtigen Faktoren Ihres Bau- oder Kaufvorhabens geklärt und schriftlich festgehalten wurden. Ansonsten drohen bei einer Rückabwicklung hohe Kosten, wie Vertragsstrafen und Nichtabnahmeentschädigungen."
Vier Wochen später unterzeichnete das Paar dann noch ein KfW-Darlehen über 100.000 EUR. Schließlich teilten sie dem Verkäufer mit, dass nun ein Notartermin möglich wäre. Der Verkäufer informierte sie jedoch darüber, dass er das Haus aus persönlichen Gründen doch nicht verkaufen wolle. Die Bank trat daraufhin vom Darlehensvertrag zurück und verlangte von den potentiellen Käufern eine Nichtabnahmeentschädigung von 35.862,29 EUR, die das Paar vollständig bezahlte. Den Betrag forderten sie von dem Darlehensvermittler als Schadensersatz zurück und klagten. Das Landgericht hat den Darlehensvermittler zur Zahlung der Hälfte verurteilt, das Oberlandesgericht (OLG) daraufhin die Klage insgesamt abgewiesen.
Der BGH hob als letzte Instanz das OLG-Urteil nun auf und wies die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung an den dortigen Senat zurück. Denn ein nicht gebundener Vermittler von Immobiliarverbraucherdarlehensverträgen schuldet seinen Kunden eine umfassende und richtige Aufklärung über die in Betracht kommenden Finanzierungsmöglichkeiten. Im Rahmen der geschuldeten Aufklärung darf ein reales Risiko (hier: Nichtzustandekommen des Grundstückskaufvertrags nach bereits geschlossenem und nicht mehr widerruflichem Darlehensvertrag) nicht derart verharmlost werden, dass der Eindruck entsteht, es sei nur theoretischer Natur. Zu einer umfassenden Aufklärung gehört in einem solchen Fall ein Hinweis auf die Möglichkeit einer zeitlichen Staffelung: Es wäre in Betracht gekommen, dass die Käufer ihre auf den Abschluss der Darlehensverträge gerichteten Willenserklärungen später abgeben oder den Notartermin vorziehen.
Hinweis: Nun wird also die Vorinstanz die Angelegenheit nochmals prüfen und entscheiden müssen. Alles spricht dafür, dass der Makler des Darlehensvertrags wegen Nichterfüllung der Aufklärungspflichten zu zahlen hat.
Quelle: BGH, Urt. v. 20.02.2025 - I ZR 122/23
| zum Thema: | Sonstiges |
(aus: Ausgabe 06/2025)
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat kürzlich den lettischen Fall eines jungen Sportlers bewertet. Und man ahnt es: Wenn der EuGH von einem Unionsmitglied angefragt wird, entfaltet das Urteil auch in der übrigen Union seine Wirkung. Da sich der Fall um den Sportnachwuchs und seine Vertragskonditionen dreht, ist er für das sportverrückte Deutschland sicherlich nicht uninteressant.
Im Jahr 2009 schloss ein minderjähriger Sportler einen Vertrag mit einem lettischen Unternehmen ab. Dabei wurde er durch seine Eltern vertreten. Dem Jungen sollte dabei eine erfolgreiche Karriere als Berufssportler im Basketball ermöglicht werden. Der Vertrag war für die Dauer von 15 Jahren abgeschlossen und sah eine Reihe von Dienstleistungen vor - unter anderem Training, sportmedizinische Leistungen, psychologische Begleitung sowie Unterstützung im Bereich Marketing, Rechtsberatung und Buchhaltung. Dafür sollte der Junge bei erfolgreicher Profikarriere 10 % sämtlicher während der Laufzeit des Vertrags erzielten Nettoeinnahmen aus Sportveranstaltungen, Werbung, Marketing und Medienauftritten im Zusammenhang mit dem betreffenden Sport zahlen, sofern seine Einnahmen mindestens 1.500 EUR pro Monat betrugen. Der Junge wurde zwischenzeitlich ein erfolgreicher Profibasketballspieler und musste an das Unternehmen mehr als 1,6 Millionen EUR zahlen. Dieses Geld verlangt er nun zurück. Die lettischen Gerichte hielten die Vertragsklausel durchaus für missbräuchlich, setzten jedoch das Verfahren aus und legten dem EuGH die Frage zur Vorabentscheidung vor.
Der EuGH hielt die Richtlinie 93/13/EWG über missbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen für anwendbar. Eine Vertragsklausel, die einen jungen Sportler verpflichtet, einen Teil seiner Einnahmen zu zahlen, falls er Berufssportler werde, könne durchaus missbräuchlich sein. Das nationale Gericht muss nun die Missbräuchlichkeit einer solchen Klausel prüfen - unter Berücksichtigung insbesondere ihrer Klarheit und Verständlichkeit in Bezug auf die wirtschaftlichen Folgen dieser Verpflichtung. Dabei kann der Umstand, dass der Sportler zum Zeitpunkt des Abschlusses minderjährig gewesen war und dieser Vertrag von seinen Eltern in seinem Namen geschlossen wurde, für die Beurteilung der Missbräuchlichkeit relevant sein.
Hinweis: Immer wieder werden Vertragsklauseln in Verträgen von Sportlern von den Gerichten für unwirksam erklärt. Im Zweifel kann dies ein Rechtsanwalt genau beurteilen.
Quelle: EuGH, Urt. v. 20.03.2025 - C-365/23
| zum Thema: | Sonstiges |
(aus: Ausgabe 06/2025)
Der Bundesgerichtshof (BGH) musste sich erneut mit der Corona-Pandemie beschäftigen - und das sicherlich nicht zum letzten Mal. Wer meint, es müsse doch mal gut sein, dem sei gesagt, dass die meisten der diesbezüglichen Urteile auch für andere ansteckende Krankheiten interessant sein werden. Die Frage hier war, ob ein positiver PCR-Test eines Reisenden im Ausland Rückzahlungsansprüche bedingt.
Ein Mann hatte für sich, seine Ehefrau und den damals zweijährigen gemeinsamen Sohn eine Kreuzfahrt, beginnend auf Mallorca, gebucht. Den Reisepreis in Höhe von 1.400 EUR hatte er vollständig bezahlt. Der PCR-Test, dem sich der Sohn des Mannes bei der Einschiffung am Morgen laut Anordnung des spanischen Gesundheitsministeriums unterziehen musste, ergab ein positives Ergebnis. Der Familie des Klägers wurde daraufhin die Teilnahme an der Reise verweigert. Nach zwei Tagen in einem Quarantänehotel auf Mallorca flog die Familie schließlich wieder nach Hause. Nun wollte der Mann die Rückzahlung des Reisepreises erhalten und eine Entschädigung in gleicher Höhe wegen nutzlos aufgewendeter Urlaubszeit. Weiterhin ging es ihm um Ersatz von Kosten für den Flug, die Unterbringungsbeförderung und Ähnliches. Das Geld erhielt er allerdings bislang nicht.
Der BGH sagte dazu, dass Umstände, die in die Risikosphäre einer Vertragspartei fallen, grundsätzlich keine unvermeidbaren, außergewöhnlichen Umstände sind. Deshalb habe der Reiseveranstalter seinen Anspruch auf den Reisepreis nicht verloren. Unter diesen Prämissen geht der Fall somit zurück an die Vorinstanz.
Hinweis: Der Kläger wird mit großer Wahrscheinlichkeit seine Klage verlieren.
Quelle: BGH, Urt. v. 18.02.2025 - X ZR 68/24
| zum Thema: | Sonstiges |
(aus: Ausgabe 06/2025)
Ratgeber Recht
Unsere Schleswig-Holsteinische Rechtsanwaltskammer veröffentlicht zusammen mit der Rechtsanwaltskammer Koblenz regelmäßig aktuelle Verbraucherhinweise zu aktueller Rechtsprechung und Gesetzesänderungen auf der Seite www.Ihr-Ratgeber-Recht.de.
Dieser Ratgeber dient der Information und ersetzt keine anwaltliche Beratung - sprechen Sie uns daher gerne auf weitergehende Fragen oder die Bedeutung für Ihren Fall an!
Unsere Rechtsanwaltskammer erreichen Sie bei Interesse auch ganz zeitgemäß über Facebook oder über die Website unter http://rak-sh.de.
Dieses Angebot unserer Kammer bedeutet einen deutlichen Mehrwert auch für unsere Mandanten!
Neu: Ratgeber Recht auch auf dem Smartphone
Der Deutsche Anwaltsverein (DAV) bietet verschiedene Apps für den Verbraucher zur Nutzung auf dem Smartphone an, welche zur ersten Orientierung bei Rechtsfragen sehr hilfreich sein können. Sowohl im Verkehrsrecht als auch im Familienrecht macht es dann oft einen erheblichen Unterschied, ob Sie frühzeitig mit anwaltlicher Hilfe tätig werden.
Als Anwälte und Anwältinnen Ihres Vertrauens helfen wir Ihnen gerne weiter!
Blutalkoholrechner
Sie möchten wissen, wie sich Alkoholkonsum auf den Blutalkoholspiegel auswirkt? Der Blutalkoholrechner des Deutschen Anwaltvereins hilft Ihnen weiter. Was das für Ihren Fall bedeutet, erläutert Ihnen unser Fachanwalt für Verkehrsrecht.
Bußgeldrechner
Sie haben eine rote Ampel übersehen oder sind geblitzt worden? Mit der App des Deutschen Anwaltvereins können Sie direkt Ihr Bußgeld ermitteln. Die Einschaltung eines Fachanwalts für Verkehrsrecht hilft bei der Schadensbegrenzung.
Laden im App Store
Android App bei Google Play
Unterhaltsrechner
Mit der Unterhalts-App lässt sich ein guter erster Eindruck gewinnen, welchen Unterhaltsanspruch Sie oder ein Angehöriger / Ehepartner voraussichtlich haben. Anwaltliche Beratung stellt sowohl für Unterhaltsberechtigte als auch für Unterhaltsverpflichtete sicher, dass der Unterhalt im Einzelfall richtig berechnet wird.